In der Medizin sind alle gleich?
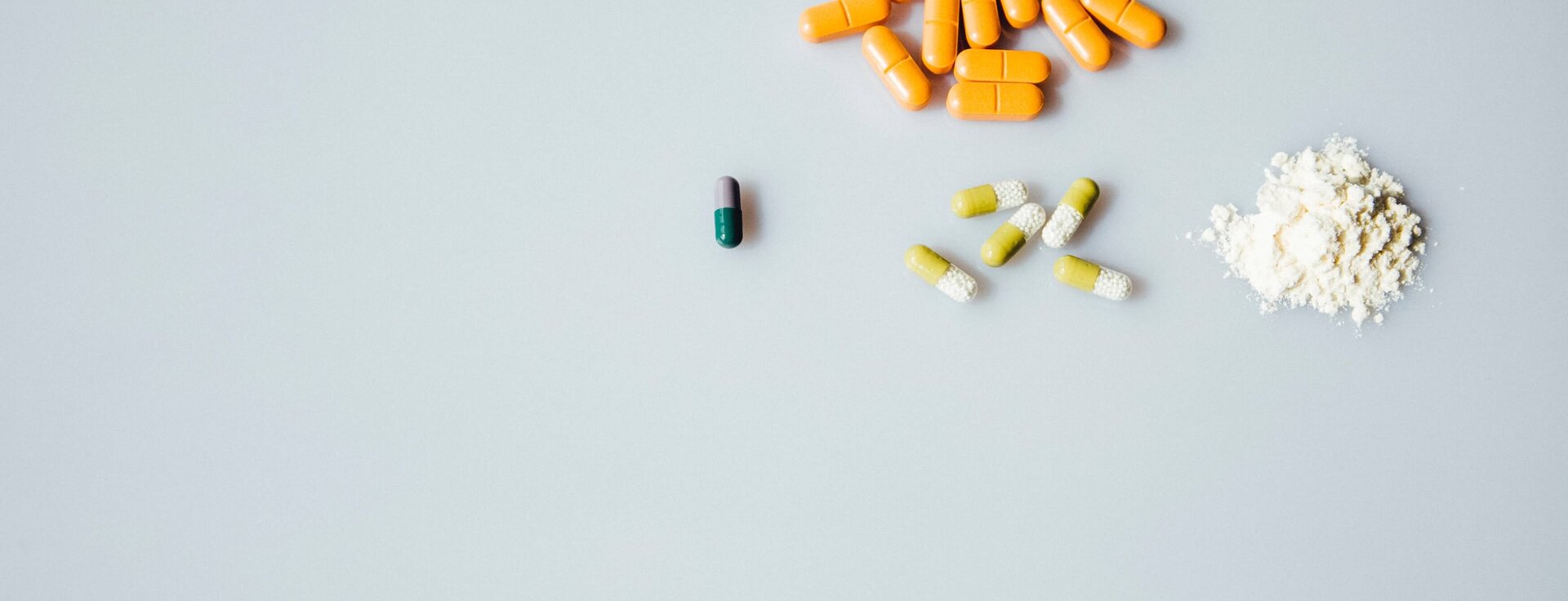
Weibliche Körper funktionieren anders als männliche. Trotzdem hat die Medizin lange Zeit weibliche Krankheitssymptome nicht erforscht und Frauen in klinischen Studien ignoriert. Die geschlechtersensible Medizin will das ändern. Und das kann auch Männern helfen.
Wer an Herzinsuffizienz litt, also einem zu schwachen Herzmuskel, bekam früher vom Arzt Digoxin verschrieben. Der Wirkstoff sollte das Herz unterstützen und so das Leben verlängern. Was man damals nicht wusste: Digoxin funktioniert nur bei Männern. An einer klinischen Studie für das Mittel aus dem Jahr 1997 hatten zwar auch 1.500 Frauen teilgenommen – neben 5.200 Männern. Doch die Forschenden werteten die Ergebnisse nicht nach Geschlechtern aus. Erst im Jahr 2002 zeigte sich bei einer erneuten Auswertung der Studie, dass sich die Einnahme von Digoxin zwar bei Männern positiv auf Herz und Lebenserwartung auswirkt, bei Frauen jedoch häufig sogar zum Tod führt.
Medizinforschung orientiert sich am Mann
Bis heute gilt der Mann in der Medizin als Norm. Frauen oder gar inter- und transgeschlechtliche Personen sind in klinischen Studien unterrepräsentiert, ihre Krankheitsbilder wenig erforscht. Es klafft eine Lücke in der Datenlage, die sogenannte Gender Health Gap. In der noch jungen Disziplin der sogenannten geschlechtersensiblen Medizin versuchen Forschende und Behandelnde daher, alle Geschlechter in die Forschung und den klinischen Alltag einzubeziehen.
Te:nor hat Ute Seeland gefragt, warum die Perspektive in Medizin und Forschung bis heute männlich geprägt ist. Die Medizinerin ist Dozentin für geschlechtersensible Medizin an der Charité in Berlin und Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin.
Wieso sind Frauen, Inter- und Transpersonen in der Medizin noch immer unterrepräsentiert, Frau Seeland?
Das hat historische Gründe. Als die ersten medizinischen Fakultäten an den Universitäten gegründet wurden, durften nur Männer studieren. Gleichzeitig sind Frauen wegen ihres Kräuter- und Medizinwissens als Hexen verbrannt worden. Das hat dazu geführt, dass von Beginn an nur die männliche Perspektive die Medizin geprägt hat.
Frauen jahrzehntelang ausgeschlossen
Zwischen den 1960er und 1990er Jahren wurden Frauen von klinischen Studien fast komplett ausgeschlossen. Ein Grund dafür war der Contergan-Skandal: Schwangere Frauen hatten Anfang der 1960er-Jahre das Beruhigungsmittel Contergan genommen, was in vielen Fällen zu Fehlbildungen bei den Babys führte. Aus Angst, dass so etwas auch bei Medikamentenstudien passieren könnte, durften junge Frauen nicht an den Studien teilnehmen. Medikamente wurden daher fast ausschließlich an Männern getestet. Für Frauen gab es jahrzehntelang keine Daten darüber, wie sie auf Medikamente reagieren oder wie ein Wirkstoff für sie dosiert werden müsste. Das ist vor allem deshalb problematisch, weil sich später zeigte, dass Frauen oft unter anderen und häufigeren Nebenwirkungen leiden als Männer. Auch heute nehmen immer noch weniger Probandinnen als Probanden an frühen Phasen der Medikamentenstudien teil.
Dass Frauen in Studien lange Zeit unterrepräsentiert waren, hat auch wirtschaftliche Gründe: Da der weibliche Körper stärkeren hormonellen Schwankungen ausgesetzt ist, würde die Teilnahme von mehr weiblichen Testpersonen Studien verkomplizieren und teurer machen. Hinzu kommt das Risiko einer Schwangerschaft bei jungen Frauen: Sie müssen doppelt verhüten, wenn sie Teil einer Studie sein wollen – also etwa mit Pille und Kondom. Doch auch die Pille verändert den Hormonhaushalt. Ergebnis: „Es gibt so gut wie kein Medikament, das für Frauen mit Zyklus entwickelt wurde“, sagt Seeland.
Mittlerweile hat die Politik auf die Gender Health Gap in der Medizin reagiert. Seit 2004 gibt es in Deutschland ein Gesetz, das Pharmaunternehmen vorschreibt, Geschlechtsunterschiede bei der Wirkung von Medikamenten zu ermitteln. Und seit Februar 2022 müssen Arzneimittelhersteller in der EU außerdem klinische Studien so durchführen, dass der Teilnehmerkreis repräsentativ zur Bevölkerung ist. Für Deutschland bedeutet das, dass ähnlich viele Frauen wie Männer an den Studien teilnehmen.
Wie müssten klinische Studien aussehen, damit sie geschlechtersensibel sind?
Es müsste vor allem nach Hormonstatus unterschieden werden. Also beispielsweise Frauen vor, während und nach der Menopause. Außerdem Männer vor und nach ihrem 40. Lebensjahr. Wichtig ist nicht nur, dass alle diese Personengruppen an Studien teilnehmen – man muss die Studien dann natürlich auch differenziert auswerten, also zum Beispiel die Wirkungen und unerwünschten Wirkungen bei Menschen mit einem höheren Östrogenspiegel vor der Menopause und einem niedrigeren Östrogen und Progesteronspiegel nach der Menopause im Blut erfassen und analysieren.
Auch der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland (VFA) äußert sich zu der Thematik. Laut VFA seien heutzutage in den ersten Studienphasen der Medikamentenentwicklung tatsächlich meist ausschließlich männliche gesunde Probanden beteiligt. Die Begründung: Zu diesem Zeitpunkt sei es wichtig zu verstehen, wie sich das Medikament im Körper verhält, ohne dass Hormonschwankungen oder hormonelle Verhütungsmittel die Wirkung beeinflussen. In späteren Studienphasen nähmen dann zwischen 30 bis 80 Prozent weibliche Probandinnen teil. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern seien aber „fast immer geringer als die individuellen Unterschiede von Mensch zu Mensch“, heißt es auf der Webseite des VFA. Damit ist gemeint, ob man beispielsweise trainiert oder untrainiert ist, jung oder alt, raucht oder nicht raucht.
Gleichbehandlung mit fatalen Folgen
Die Forschung der geschlechtersensiblen Medizin ist sich jedoch mittlerweile einig: Frauen sind eben nicht einfach nur etwas kleinere Männer. Sie haben andere Symptome, auch das Schmerzempfinden ist anders. Lange Zeit wurden beispielsweise Herzinfarkte bei Frauen nicht erkannt. Denn während Männer bei einem Herzinfarkt häufig über stechende Schmerzen im Arm und ein Engegefühl in der Brust klagen, leiden Frauen eher unter Atemnot, Schmerzen im Oberbauch, Schweißausbrüchen oder Übelkeit. Ärzte erkannten das nicht als Herzinfarkt – und behandelten ihre Patientinnen oft viel zu spät. Forschende gehen außerdem davon aus, dass Frauen ein stärkeres Immunsystem haben, deshalb aber auch häufiger unter Autoimmunkrankheiten leiden und stärker auf Impfungen reagieren. Diese Beispiele zeigen: Wenden Ärztinnen und Ärzte die gleichen Maßstäbe bei Frauen wie bei Männern an, kann das fatale Folgen haben und im schlimmsten Fall zum Tod führen.
Profitieren auch Männer von der geschlechtersensiblen Medizin?
Eine stärkere Differenzierung in klinischen Studien würde nicht nur den Frauen helfen. Bisher werfen wir alle Daten in einen Topf und es kommt ein Ergebnis für einen Menschen heraus, den es eigentlich gar nicht gibt. Wenn 70 Prozent der Probanden Männer sind und 30 Prozent Frauen, dann passt das Ergebnis auch nicht hundertprozentig für die Männer.
Immerhin hat Gendermedizinerin Seeland das Gefühl, dass sich im Gesundheitssystem etwas verändert. Aktuell sei geschlechtersensible Medizin vor allem in Lehre und Forschung ein Thema, sagt sie. Ihr Ziel ist es, die Erkenntnisse auch in den klinischen Alltag mitzunehmen, damit Menschen jedes Geschlechts angemessen behandelt werden.
2 Mal
so hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei Frauen als bei Männern, an einem Herzinfarkt zu sterben.
Quelle: Europäische Gesellschaft für Kardiologie, 2023
25 Prozent
wahrscheinlicher als bei Männern ist es, dass Frauen nach einem Schlaganfall eine Fehldiagnose erhalten.
Quelle: Newman-Toker et al. 2014

Tiefsee, tote Wale und eine bedrohte Fjordwelt – was nach Thriller klingt, war für die deutsch-chilenische Meeresbiologin Vreni Häussermann lange Alltag. Mehr als zwei Jahrzehnte erforschte sie die patagonischen Fjorde und dokumentierte, wie Klimawandel und menschliche Eingriffe die Unterwasserwelt verändern. Im Interview zum Weltfrauentag spricht sie über Widerstände in der Forschung – und darüber, wie wichtig es ist, auf die Zerstörung der Natur aufmerksam zu machen.

Weltweit gründen Frauen so viele Unternehmen wie nie zuvor. Dennoch fließt kaum zusätzliches Kapital in diese Unternehmen. Obwohl seit Jahrzehnten über Gleichberechtigung gesprochen wird, hat sich wenig getan: Frauen erhalten nach wie vor nur einen Bruchteil der verfügbaren Investitionsmittel und sind in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert.

IT und Finanzen – Lisa Osada kennt gleich zwei Männerdomänen aus dem Effeff. Im Te:nor-Interview erzählt die Gründerin des Blogs Aktiengram.de, warum es wichtig ist, solche Themen in unseren Alltag zu lassen und warum Frauen auch ruhig einmal mehr riskieren sollten.

Seit drei Jahren kümmert sich Försterin Nathalie Kolb im Süden Bayerns um den Erhalt der Natur. In Zeiten des Klimawandels gestaltet sie die Zukunft des Waldes mit. Dabei muss sie sich nicht nur mit Hirschen, Wildschweinen und Borkenkäfern herumschlagen, sondern auch mit Männern.